
Im Mittelalter waren römische Zahlen (bzw. die römische Zahlschrift) omnipräsent, bspw. bei Jahreszahlen, Kapitelnummern, Inschriften, Zählungen sowie Verträgen und Münzen. Bis heute gibt es zahlreiche Relikte hiervon, die diese einstige Bedeutsamkeit der römischen Zahlen belegen. Das war aber einmal! Warum ist das aber nicht mehr so? Warum sind die römischen Zahlen heute nur noch quasi im Grundschulunterricht kurzzeitig relevant – und sonst in der Mathematik und anderswo überhaupt nicht mehr? Oder anders gefragt: Warum haben die arabischen Zahlen ganz offensichtlich die römischen Zahlen als Zahlensystem „verdrängt“? Das Verschwinden des Lateins als Gelehrtensprache, als lingua franca, als Verkehrssprache und Standardschrift im Mittelalter, erklärt den Wegfall in den oben genannten Bereichen. Warum „verdrängten“ aber die arabischen Zahlen zur Gänze die römischen Zahlen als Zahlensystem?
Verwendungsbereiche der römischen Zahlen
Die römischen Zahlen wurden über viele Jahrhunderte während des Mittelalters, als Latein die Gelehrtensprache war, umfangreich verwendet: Jahreszahlen (DCCC = 800, Kaiserkrönung Karls des Großen, MCCCXLVIII = 1348, die Pest erreicht Europa, MCDXCII = 1492, Christoph Columbus entdeckt Amerika), Kapitelnummern (I = Kapitel 1, V = Kapitel 5, XII = Kapitel 12), Inschriften (Kirchen und Klöster: ANNO DOMINI MCCLXXV = Im Jahr des Herrn 1275, Urkunden und Rechtsdokumenten: ACTUM EST ANNO MCCCXL = Es geschah im Jahr 1340, Herrscher und Titel: FRIDERICUS II IMPERATOR = Friedrich II., Kaiser, Grabinschriften: OBIIT ANNO DOMINI MCCCXII = Verstorben im Jahr des Herrn 1312), Zählungen (Konzilsbeschlüsse, Synoden, kirchliche Ordnungen: Canon I, Canon II, Canon III usw., Verzeichnisse in Handschriften: Argumentum I, II, III usw., Herrschernamen mit Ordnungszahlen: HEINRICVS IV = Heinrich der Vierte, Aufzählung von Heeres- und Ritterlisten: Miles I, II, III usw.), Verträgen und Münzen (Datumsangaben mit Tagesangaben, ANNO DOMINI MCCXLVII DIE XVI mensis MARTII = Im Jahr des Herrn 1247 am 16. Tag des Monats März, Artikelnummerierungen: Capitulum I, II, III usw., Geldbeträge: Centum Libras = 100 Pfund) – all diese Verwendungszwecke geben noch bis heute ein beeindruckendes Zeugnis von der früheren großen Bedeutsamtkeit dieser Zahlen.
Was bei jeglichen dieser Beispiele aber auffällt, ist: Die römischen Zahlen wurden hier ausschließlich zur Zahlendarstellung benutzt. Dieser Zahlendarstellung lag wiederum ein bestimmtes Zahlensystem zugrunde.
Römische Zahlen als Zahlensystem
Wie sieht nun das Zahlensystem der römischen Zahlen bzw. der römischen Zahlschrift aus? Denn eigentlich handelt es sich hier ja nicht um Zahlen, sondern um römische Buchstaben, denen ein bestimmter Zahlenwert zugeordnet wird. Das I steht für die Zahl 1, das V für die 5, das X für die 10, das L für die 50, das C für die 100, das D für die 500 und das M für die 1000.
Darüber hinaus gibt es bestimmte Regeln.
Bei der Anordnung der römischen Zahlenschrift gilt Folgendes: Steht ein kleinerer Zahlenwert rechts neben einem größeren, dann werden die Zahlenwerte zusammengezählt, also addiert: XV = 15, CI = 101; steht hingegen ein kleinerer Zahlenwert links neben einem größeren, dann werden die Zahlenwerte abgezogen, also subtrahiert: IX = 9, XC = 90.
Die Anordnung der Zahlenwerte unterliegt zudem noch einer weiteren wichtigen Regel: Es dürfen maximal drei gleiche Zahlenwerte nebeneinander stehen, wie z. B. XXX oder CCC.
Die Anordnung der Zahlenwerte beim Abziehen bzw. bei der Subtraktion unterliegt ferner einer Einschränkung. Denn es sind nur bestimmte Subtraktionen erlaubt: I darf nur vor V und X stehen, X darf nur vor L und C stehen und C nur vor D und M. Hier fragt man sich zu Recht, wofür diese Einschränkung ist. Sie dient aber dazu, dass nicht verschiedene Subtraktionen einen Zahlenwert ergeben und somit eine Zahlenwert-Verwirrung vermieden wird bzw. eine größere Klarheit in der Anordnung der Zahlzeichen! Ohne diese Einschränkung wäre es ja möglich, bestimmte Zahlenwerte mittels der römischen Zahlzeichen verschieden darzustellen. So ergibt nach dem Regelwerk der römischen Zahlen XLIX = 49, ohne die Einschränkung der Subtraktion könnte man mittels der römischen Zahlzeichen aber auch IL = 49 schreiben.
Das ist das komplette Zahlensystem.
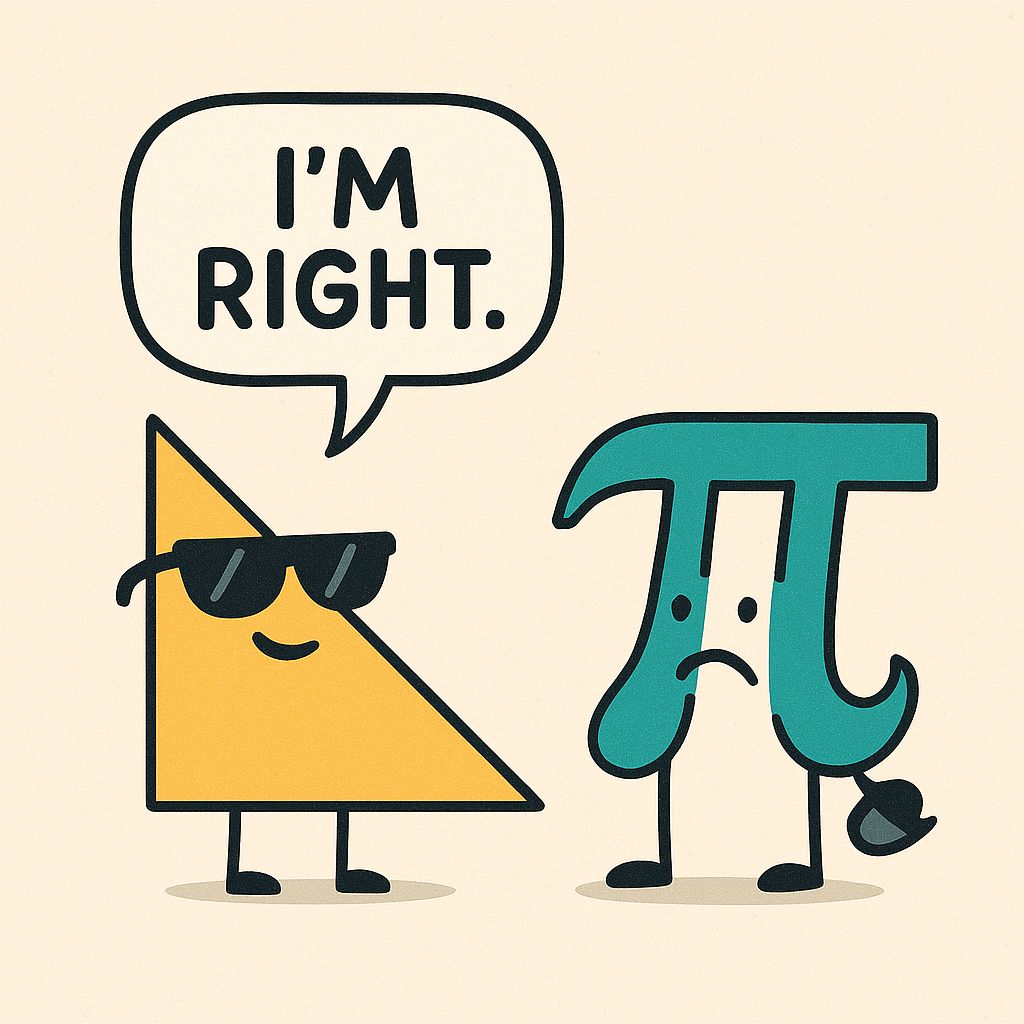
Die Begrenztheit des Zahlensystems vom Aufbau her
Die römischen Zahlen weisen insgesamt 7 verschiedene Zahlzeichen auf. Bei der konkreten Anwendung der Zahlzeichen ergibt sich aber ein maximaler Zahlenwert, und zwar: MMMCMXCIX = 3999. Einen größeren Zahlenwert kann man mit den einem zur Verfügung stehenden römischen Zahlzeichen nicht darstellen.
Wenn man nun größere Zahlenwerte darstellen wollen würde, dann geht das mit den klassischen römischen Zahlen, so wie wir sie heute noch kennen, nicht. Daher müsste man für größere Zahlwerte über 3999 selbst weitere Zahlzeichen festlegen bzw. definieren. Und das müsste man immerfort weitermachen, da irgendwann ja wieder eine Zahlenwertobergrenze erreicht werden würde. Das ist aus mathematischer Sicht absolut unbefriedigend, da das Inventar an Zahlzeichen nie enden würde – und das nur, um bestimmte Zahlenwerte darzustellen! Und was für „Zahlzeichen-Ungetüme“ dann entstehen würden – davon ganz abgesehen! Allein schon die römische Zahl für 3999 sagt hier schon alles, da sie aus 9 schwierig zusammengesetzten Zahlzeichen besteht!
Im Gegensatz dazu benötigen die arabischen Zahlen lediglich 10 Ziffern (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), um jedwede Zahl – egal wie groß – darstellen zu können!
Ein weiterer großer Mangel zeigt sich in den klassischen römischen Zahlen: Es gibt überhaupt gar kein Zahlzeichen für den Zahlenwert 0. Aus antiker Sicht stellte das kein Problem dar. Es gab für diese Zahl einfach bei den Römern keine praktische Verwendung, da Zahlendarstellungen in Aufzeichnungen, Mengenangaben, Bauwerken oder beim Zählen (mittels Addition und Subtraktion der römischen Zahlzeichen) genutzt wurden – und der Zahlenwert 0 hier nicht vonnöten war. Der Zahlenwert 0 kam daher in der römischen Antike primär im mündlichen Gebrauch zum Zuge (nullus = null auf Latein).
Der Begrenztheit der römischen Zahlen beim Rechnen mittels Addition und Subtraktion
Die Begrenztheit der römischen Zahlen zeigt sich aber auch entschieden beim Rechnen, sprich bei den Rechenoperationen der Addition oder Subtraktion.
Wenn man nun 12 + 8 mittels der römischen Zahlen addieren will, muss man das folgendermaßen machen:
Zuerst fügt man die Zahlzeichen zusammen:
XII + V III = XIIVIII
Dann ordnet man die Zahlzeichen von ihrer Wertigkeit her, beginnend mit dem größten Wert:
X V I I I I I
Man ersetzt nun die Zahlzeichen, die anderweitig dargestellt werden können:
IIIII = V, V V = X
Dadurch ergibt sich:
XX
Um einiges schwieriger wird die Addition bei den römischen Zahlen, wenn man höhere Zahlenwerte addieren möchte, wie z. B. 47 + 76.
XLVII + LXXVI = XLVIILXXVI (Zusammenfügen der Zahlzeichen)
Bevor man die römischen Zahlen nach ihrer Wertigkeit ordnen kann, muss man hier die Subtraktion bei XL berücksichtigen, ansonsten erhält man ein falsches Ergebnis. Konkret heißt das, dass man für XL = XXXX schreiben muss.
L X X X X X X X V V I I I (Ordnen der Zahlzeichen nach Wertigkeit)
L, X X X X X = L, X X, V V = X, III also:
LLXXXIII = 123
Das hat mit dem Rechnen, wie man es in der Grundschule in Mathematik gelernt hat, nichts zu tun – da hier nur Zahlzeichen ausgetauscht werden!
Bei der Subtraktion von römischen Zahlen verhält es sich im Großen und Ganzen ähnlich wie bei der Addition.
Wenn man die Zahl 20 von 8 abziehen möchte, verfährt man wie bei der Addition, man zerlegt aber die größeren Zahlzeichen in kleinere, damit man die Subtraktion einfacher, sprich: ohne Fehler – durchführen kann:
XX – VIII = XVIIII – VIII
Hier gilt natürlich auch, dass man die Subtraktion bereits anwenden muss, bevor man die römischen Zahlen nach ihrer Wertigkeit ordnen kann.
X I I (Ordnen der Zahlzeichen nach der Wertigkeit)
XII = 12
Komplizierter wird das wieder, wenn man größere Zahlen hat, wie z. B. bei 76 – 47:
LXXVI – XLVII
Hier muss man die römischen Zahlzeichen schrittweise zerlegen, um die Subtraktion korrekt durchführen zu können. Man zerlegt hier L in XXXXX, X = VIIIII.
LXXVI – XLVII = XXXXXXVVIIIIII – XXXXVII
X X V I I I I (Ordnen der Zahlzeichen nach der Wertigkeit)
XXIX = 29
Mit der Subtraktion, wie man diese Rechenoperation in der Grundschule in Mathematik lernt, hat das (wie bei der Addition) nichts zu tun. Das liegt daran, dass bei den römischen Zahlen nur Zahlenwerte bestimmten Ziffern zugeordnet werden, bei den arabischen Zahlen aber ein Stellenwertsystem zugrunde liegt!
Hier bspw. bei III steht das I jeweils für den Zahlenwert 1; bei 111 steht die 1 aber je nach Stelle für einen anderen Wert! Von rechts nach links gelesen: Bei der ersten Stelle für 1 Einer, bei der zweiten Stelle für 1 Zehner und an der dritten Stelle für 1 Hunderter.
Aufgrund ihrer Begrenztheit wurden die römischen Zahlen peu à peu durch die arabischen Zahlen ersetzt – da die arabischen Zahlen ein kleineres und vor allem viel einfacher handhabbareres Zahleninventar haben – und man mit diesen auch wirklich (!) rechnen kann.